Aktuelle Trainingszeiten ab 13.10.2023
Dienstag - 19.00-20.45 Uhr
Freitag - 19.00-20.45 Uhr
vollständige Dojo-Infos
Wir sind Mitglied in der MAA-I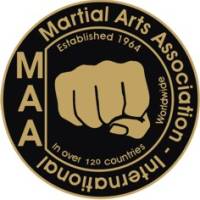
In Japan ist der Gesang der Zikaden mehr als bloß ein Klang der Natur.
Er ist ein Teil des kollektiven Gedächtnisses, ein Echo aus alten Zeiten, ein steter Begleiter in Literatur, Kunst und Alltagsleben. Wer im heißen August durch einen Tempelgarten wandert, wird unweigerlich von ihrem Lied umfangen – einem Lied, das von Vergänglichkeit, Schönheit und Sehnsucht erzählt. Dieser Beitrag nimmt den Leser mit auf eine kurze Reise durch die Jahrhunderte: vom alten Hof in Heian-kyō über die Zen-Gärten der Krieger, die belebten Straßen Edos bis ins heutige Tokio, wo das Lied der Zikaden in Kindheitserinnerungen und Filmsequenzen weiter klingt.
Zikaden in der frühen japanischen Literatur (8.–12. Jahrhundert)
Stellt euch die Hofgärten der Heian-Zeit vor: hohe Mauern, hinter denen Kirschbäume und Pflaumenblüten in den Himmel greifen. In diesen Gärten, inmitten von Teichen und Brücken, schwebt der Gesang der Zikaden durch die feuchte Sommerluft. Dichter des Manyōshū lauschten diesem Lied und fanden in ihm ein Sinnbild für das Herz des Menschen – sehnsüchtig, vergänglich, immer im Werden und Vergehen. Das Genji Monogatari, der große Roman jener Zeit, lässt den Klang der Zikaden die inneren Stürme der Figuren widerspiegeln: Liebe, Verlust, Vergänglichkeit. Ihr Lied wurde zur Stimme der Natur, die sanft mahnt: „Nichts währt ewig.“
Die Zikade in der mittelalterlichen Ästhetik (13.–16. Jahrhundert)
Die Welt Japans war in dieser Zeit von Krieg und Umbruch geprägt. Doch in den stillen Zen-Gärten der Tempel hallte der Ruf der Zikade gleichsam wie ein Mantra. Er erinnerte an die Lehre des Buddha: Alles, was geboren wird, muss vergehen. Die Krieger lauschten dem Lied der Zikade und sahen darin ihr eigenes Schicksal gespiegelt – ein kurzes, helles Aufflammen im Strom der Zeit. In Nō-Dramen wurde das Lied der Zikade oft eingeflochten, als unsichtbarer Faden, der die Lebenden und die Toten verband.
Die Edo-Zeit (17.–19. Jahrhundert): Von der hohen Kunst zur Volkskultur
Edo, die Stadt der Händler und Handwerker, der Gaukler und Dichter. Im Schatten von Bambus und Ahorn, zwischen den Gassen der Viertel, erfüllte der Klang der Zikaden den Sommer. Haiku-Meister wie Bashō fingen dieses Lied ein in wenigen Silben:
„Der Zikade Lied –
durchdringt den Stein
Sommernachmittag.“
Nicht nur die Dichter lauschten: Kinder fingen Zikaden in kleinen Käfigen, Händler schnitzten ihr Bild in Elfenbein und Holz. Die Zikade wurde Teil des Alltags, des Spiels, des Marktes – und doch blieb ihr Lied ein Ruf, der das Herz berührte.
Moderne und Gegenwart (20.–21. Jahrhundert)
Heute erklingt das Lied der Zikade in einem anderen Japan: zwischen Hochhäusern und Schnellstraßen, in Parks zwischen Betonwänden. Doch wer es hört, wird zurückgetragen – in Kindheitstage, in heiße Nachmittage, in die Zeit der endlosen Sommerferien. In Animes und Filmen begleitet der Ruf der Zikade oft jene Szenen, in denen die Zeit für einen Moment stillzustehen scheint: das erste Geständnis, der letzte Blick, ein stiller Abschied. Ihr Lied wurde zum Klang der Erinnerung, der uns mahnt: Bewahre den Moment, ehe er verweht.
Warum die Zikade?
Warum wurde ausgerechnet die Zikade in Japan zu einem solchen Symbol? Vielleicht, weil ihr Leben selbst wie ein Gedicht ist: lange verborgen, dann ein kurzes Aufleuchten in der Welt. Ihr Gesang ist der Klang des Augenblicks, der uns innehalten lässt. Die Zikade lehrt das mono no aware – das sanfte Erkennen der Schönheit im Vergänglichen, das stille Einverständnis mit dem Lauf der Zeit.
Fazit
So singt die Zikade bis heute: in Gedichten und Filmen, in Gärten und Straßen. Ihr Lied verbindet die Jahrhunderte, mahnt und tröstet zugleich. Wer ihr lauscht, hört den Sommer, hört das Leben – und hört das Vergehen.
Quellen
Benedict, Ruth. „The Chrysanthemum and the Sword“. Houghton Mifflin, 1946.
Keene, Donald. „Seeds in the Heart: Japanese Literature from Earliest Times to the Late Sixteenth Century“. Columbia University Press, 1999.
Miner, Earl et al. „The Princeton Companion to Classical Japanese Literature“. Princeton University Press, 1985.
Varley, Paul. „Japanese Culture“. University of Hawai'i Press, 2000.